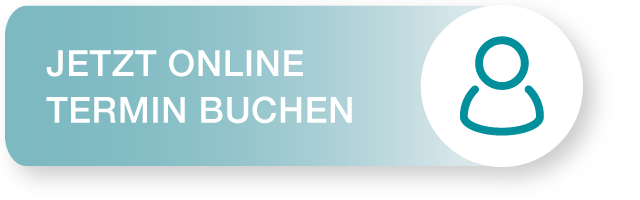Bundeshaushalt 2026: Was Unternehmen jetzt wissen sollten
Am 30. Juli 2025 hat das Bundeskabinett den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2026 beschlossen. Mit ihm werden auch die Wirtschaftspläne für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) sowie das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) verabschiedet. Noch ist nichts final beschlossen, aber bereits jetzt zeichnet sich ab, in welchen Bereichen es voraussichtlich zu Kürzungen kommt. Unternehmen, die Fördermittel nutzen möchten, sollten die Entwicklung aufmerksam verfolgen.
In diesem Artikel werfen wir einen genauen Blick auf den Entwurf zum Bundeshaushalt 2026.
1. Übersicht Energiebereiche im Haushaltsentwurf 2026
(Stand: 30. Juli 2025 – ohne Gewähr auf Vollständigkeit)
Klimaschutz im Gebäudebereich:
Rund 12,6 Milliarden Euro, davon ca. 12,1 Milliarden Euro für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). (Zum Vergleich: 2025 waren es ca. 15 Milliarden Euro.)Entlastung bei Energiekosten:
Insgesamt ca. 9,8 Milliarden Euro, davon
– etwa 6,5 Milliarden Euro zur Senkung der Netzentgelte für private Haushalte und Unternehmen
– rund 3 Milliarden Euro zur Entlastung stromintensiver UnternehmenTransformation der Industrie:
Etwa 2,7 Milliarden Euro (2025: ca. 4,8 Milliarden Euro), darunter
– ca. 1,0 Milliarden Euro für die Bundesförderung Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW)
– weitere Mittel für Klimaschutzverträge und das Investitionsprogramm BIKKlimafreundliche Energieversorgung:
Rund 1,7 Milliarden Euro (2025: ca. 1,0 Milliarden Euro), vermutlich überwiegend für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)Energieinfrastruktur (aus dem SVIK):
Ca. 2,1 Milliarden Euro, z. B. für den Ausbau und die Modernisierung des Stromnetzes oder Wasserstoffprojekte
2. Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) soll sinken
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist auch im Haushaltsentwurf 2026 der größte Einzelposten im Klima- und Transformationsfonds. Nach aktuellem Stand sollen dafür rund 12,1 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Im laufenden Jahr 2025 waren es etwa 15 Milliarden Euro. Die Reduktion der Mittel fällt also spürbar aus, kam jedoch nicht überraschend.
Die Reduktion der Mittel hängt nach Einschätzung von Fachverbänden vor allem mit dem Wegfall von Altverpflichtungen aus den Jahren der Energiekrise zusammen. In dieser Zeit wurden viele Anträge gestellt und bewilligt, deren finanzielle Abwicklung in den Folgejahren mit hohen Summen zu Buche schlug. Nun sinkt dieser Nachholbedarf.
Für Unternehmen entscheidend ist die Frage, wie hoch das Niveau der Neuzusagen im Jahr 2026 tatsächlich ausfallen wird. Diese Information ist bislang nicht öffentlich. Wichtig ist auch, dass die tatsächliche Wirkung der Mittel stark davon abhängt, wie schnell öffentliche Stellen – insbesondere Kommunen und Länder – ihre Projekte ausschreiben und umsetzen können.
Wer in den kommenden Monaten Sanierungs- oder Neubauprojekte plant, sollte die Entwicklungen rund um die BEG genau beobachten. Auch eine frühzeitige Antragstellung noch im Jahr 2025 kann sinnvoll sein, um sich Zugang zu bestehenden Förderkonditionen zu sichern.
3. Transformation wird weiter gefördert, aber mit reduziertem Budget
Für die Transformation der Industrie sieht der Regierungsentwurf 2026 Programmausgaben in Höhe von rund 2,7 Milliarden Euro vor. Das liegt deutlich unter dem Niveau des laufenden Jahres 2025, in dem rund 4,8 Milliarden Euro eingeplant waren. Dennoch bleibt das Thema Transformation auf der Agenda – wenn auch mit eingeschränkter finanzieller Ausstattung.
Ein zentrales Förderinstrument in diesem Bereich ist die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW). Sie soll im kommenden Jahr mit etwa einer Milliarde Euro ausgestattet werden. Das entspricht einem leichten Anstieg gegenüber 2025, als 900 Millionen Euro vorgesehen waren.
Zusätzlich zu EEW dürften auch weitere Programme wie die Klimaschutzverträge sowie das Investitionsförderprogramm BIK wieder Teil des Budgets sein. Details zur genauen Mittelverteilung liegen aktuell noch nicht vor.
Für energieintensive Unternehmen bleibt die EEW ein strategisch wichtiges Instrument, etwa zur Förderung von Prozesswärme, Querschnittstechnologien oder Maßnahmen zur Abwärmenutzung. Wer Investitionen in diesen Bereichen plant, sollte prüfen, ob sich eine Antragstellung noch im Jahr 2025 lohnt. Denn es ist derzeit offen, ob die künftige Mittelverteilung auch für größere Einzelvorhaben ausreicht.
4. Klimafreundliche Wäremversorgung: BEW mit stabiler Perspektive
Für die klimafreundliche Energieversorgung sieht der Regierungsentwurf 2026 Programmausgaben in Höhe von rund 1,7 Milliarden Euro vor. Nach aktuellem Stand dürften diese Mittel zum Großteil in die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) fließen. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem rund eine Milliarde Euro bereitstand, bedeutet das eine moderate Erhöhung.
Die BEW spielt eine zentrale Rolle bei der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. Gefördert werden unter anderem der Ausbau von Wärmenetzen, der Einsatz erneuerbarer Energien sowie der Anschluss von Gebäuden an bestehende Netze. Ein großer Teil der Antragsteller sind nicht privatwirtschaftliche Unternehmen, sondern kommunale Träger, insbesondere Stadtwerke. Für sie ist die BEW ein entscheidendes Instrument zur Umsetzung langfristiger Infrastrukturprojekte, zum Beispiel im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung.
Dass die BEW im Haushaltsentwurf mit erhöhten Mitteln berücksichtigt wurde, deutet auf eine gewisse Planungssicherheit hin. Die im Koalitionsvertrag vorgesehene gesetzliche Verankerung des Programms steht jedoch weiterhin aus. Auch deshalb bleibt es wichtig, laufende Entwicklungen genau zu verfolgen.
Unternehmen und Projektträger, die in Wärmenetze investieren möchten, sollten sich frühzeitig mit den aktuellen Förderkonditionen vertraut machen und prüfen, wann der geeignete Zeitpunkt für eine Antragstellung ist.
5. Entlastung bei Energiekosten und Investitionen in Energieinfrastruktur
Ein weiterer Schwerpunkt des Haushaltsentwurfs liegt auf der finanziellen Entlastung bei den Energiekosten. Insgesamt sind dafür im Klima- und Transformationsfonds rund 9,8 Milliarden Euro vorgesehen. Davon entfallen etwa 6,5 Milliarden Euro auf die Reduzierung der Netzentgelte für Haushalte und Unternehmen. Weitere 3 Milliarden Euro sind zur Unterstützung stromintensiver Unternehmen eingeplant. Zusätzlich zur Senkung der Netzentgelte sieht der Regierungsentwurf auch die Abschaffung der Gasspeicherumlage sowie eine gezielte Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe vor.
Diese Maßnahmen sollen helfen, die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Betriebe zu sichern und zugleich die Preisbelastung für kleine und mittlere Unternehmen sowie private Verbraucher zu dämpfen. Für Unternehmen, die unter stark schwankenden Energiepreisen leiden, kann dies ein wichtiger Faktor in der Standort- und Investitionsentscheidung sein.
Ergänzt werden diese Ansätze durch Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK). Für das Jahr 2026 sind dort rund 2,1 Milliarden Euro für Investitionen in die Energieinfrastruktur eingeplant. Dazu zählen unter anderem Vorhaben im Bereich Stromnetzausbau, Ladeinfrastruktur, Wasserstoffwirtschaft oder systemdienliche Speicherlösungen.
Auch wenn konkrete Projekte noch nicht benannt wurden, deutet das vorgesehene Budget darauf hin, dass die Bundesregierung weiterhin auf den Ausbau einer zukunftsfähigen Energieinfrastruktur setzt. Für Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind oder entsprechende Technologien zuliefern, ergeben sich daraus potenzielle Chancen.
Fazit zum Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2026
Der Haushaltsentwurf 2026 legt einen deutlichen Schwerpunkt auf kurzfristige Entlastungen wie die Senkung der Energiepreise und Netzentgelte. Gleichzeitig fällt die geplante Reduzierung der Mittel für die industrielle Transformation gegenüber dem Vorjahr erheblich aus. Das ist angesichts der stark steigenden Neuverschuldung ein fatales Signal.
Statt mit zukunftsorientierten Investitionen in Infrastruktur und Technologie dauerhafte Einsparungen und mehr Wettbewerbsfähigkeit zu erzielen, wird ein erheblicher Teil der verfügbaren Mittel in laufende Kosten gesteckt. Es ist bemerkenswert, dass wir mehr Geld in kurzfristige Preisentlastung investieren als in Projekte, die langfristig Effizienzgewinne und Strukturveränderungen bewirken können.
Für Unternehmen bedeutet das weiterhin Unsicherheit bei der Planung größerer Transformationsvorhaben. Ob und wie Projekte über bestehende Programme ausreichend finanziert werden können, bleibt offen. Es ist wichtiger denn je, Förderkulissen frühzeitig zu kennen und die eigene Projektplanung entsprechend auszurichten. Wer geplante Vorhaben bereits jetzt prüft und vorbereitet, kann sich Handlungsspielräume sichern und flexibel auf mögliche Veränderungen reagieren.
Der Entwurf wird im Herbst im Bundestag beraten. Je nach Konjunkturverlauf sind noch Änderungen möglich. Hier finden Sie die vollständige Pressemitteilung des Bundesministeriums für Finanzen.
Energiekosten 360 steht Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite
Wir beobachten die Entwicklungen für den Bundeshaushalt 2026 kontinuierlich und halten Sie über alle relevanten Änderungen auf dem Laufenden. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir, welche Förderprogramme für Ihre Projekte in Frage kommen, und entwickeln eine Strategie, die auf Ihre konkreten Ziele zugeschnitten ist.
Wenn Sie Fragen zur aktuellen Lage oder zu geplanten Investitionen haben, sprechen Sie uns jederzeit an. Wir unterstützen Sie mit Fachwissen, Erfahrung und Weitblick.